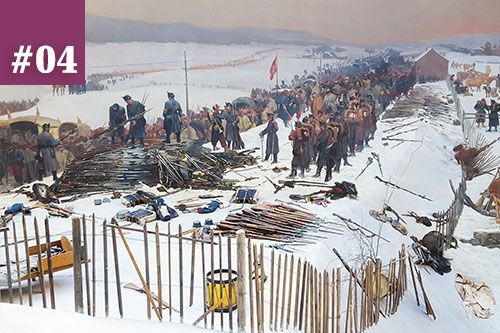Es hat ganz offensichtlich niemanden psychisch gerettet, besser Bescheid zu wissen als die Mehrheit der Gesellschaft. Aus dem Beschaffen von Informationen zur Orientierung in einer täglich bizarrer werdenden Welt, wurde Sucht: Die Sucht nach Angst und Ärger, gleich einer Sucht nach dem nächsten Schuss.
Es hat uns süchtig gemacht, uns mit immer neuen Hiobsbotschaften zu beschäftigen. Der nächste Angst- und Ärgerkick, die nächste Dosis Empörung. Durchaus verständlich: Das Corona-Regime hat Menschen auf einer ganz elementaren Ebene bedroht. Es hat ein System der Ausgrenzung manifestiert und legitimiert, das die meisten von uns sich vor 2020 nicht hätten vorstellen können, auch wenn bereits seit 2001 ein spürbarer Abbau bürgerlicher Freiheitsrechte stattgefunden hat. War dieser Prozess vor 2020 jedoch noch subtil und schleichend, im Alltag nur unterschwellig wahrnehmbar, so glich er seit März 2020 einer medialen Dampfwalze – einem Mahlstrom, der alles und jeden in sich hineinsog. Es ist eine Sucht, die wir uns nicht ausgesucht haben.
Besonders die wachen, denkenden und mitfühlenden Menschen haben die letzten zweieinhalb Jahre in einem permanenten Überlebensmodus verbracht. Die Beschäftigung mit dem Schrecken hat in unser aller Psychen Spuren hinterlassen. Besonders diejenigen, die sich entgegen aller Widerstände der Mehrheitsgesellschaft, ohne jede Selbstschonung, dem Kampf um die Deutungshoheit an der Informationsfront ausgesetzt haben, sind betroffen.
Ich spreche, wenn ich all dies schreibe, auch zu mir selbst. Mir selbst ging es oft nicht gut in den letzten zweieinhalb Jahren. Das wohl totalitärste Regime in der Geschichte der BRD hat seine Opfer gefordert: So mancher meiner Freunde hat in dieser Zeit eine handfeste Psychose entwickelt. Doch inzwischen hat sich etwas in mir selbst verändert: Ich bin so oft an diesem Land verzweifelt – an seinem strukturellen Sadismus, seiner menschenverachtenden Borniertheit und seinem kleingeistigen Hinterwäldlertum-, dass inzwischen keine Ressourcen für Angst und Verzweiflung mehr übrig sind. Ich hatte so viel Angst, dass jetzt schlichtweg keine Angst mehr da ist. Wann immer ich heute spüre, dass jemand mir Angst machen möchte, so schalte ich innerlich auf Durchzug …
Jene neu gefundene, innere Abgeklärtheit hat ihre Vorteile: Zwar fühle ich weiterhin mit den Opfern dieses Regimes – mit all jenen, die sich nicht wehren können, die nicht auswandern können. Mit den Kindern, den Familien, den älteren Menschen, den Angestellten in Pflegeberufen und Berufen, in denen sie sich der Maskenpflicht und Impfmandaten nicht entziehen können.
Doch in punkto Mehrheitsgesellschaft, die all dies noch überzeugt mitträgt, ist mein Bedürfnis, mit Sachargumenten zu überzeugen, nun einem entspannten Zynismus gewichen. Und angesichts dessen, was noch alles auf dieses Land zukommen mag – sogar durchaus einer gewissen Schadenfreude. Auch wenn mir sehr wohl bewusst ist, dass dies Gefühle sind, mit denen man nicht unbedingt auf spirituelle Erleuchtung hoffen kann, so schaffen sie in der derzeitigen Situation dennoch eine wohltuende Distanz zum Weltgeschehen.
Mir ist klar geworden, dass man die hiesige Gesellschaft nicht daran hindern kann, in ihr eigenes Unglück zu rennen. Ich kann montags spazieren gehen, mich aber gleichzeitig auch innerlich entspannt zurücklehnen.
Ich weiss, dass viele gute, reflektierte Menschen in diesen Tagen einsam und verzweifelt sind. Ich habe für diese Verzweiflung keine Patentlösung parat, zumal es sich immer leicht sagt, wenn man selbst nicht existenzgefährdet und sozial gut eingebettet ist. Ich kann daher nur weitergeben, was mir selbst hilft und gut tut. Wie etwa: Sich so oft wie irgend möglich mit guten Menschen treffen. Es gibt definitiv eine grosse und stabile Gegenkultur in diesem Land. Man kann erbauliche Vorträge besuchen, sich im realen Leben mit Gleichgesinnten austauschen. Man kann Stammtische gründen. Man kann «Banden bilden». Man kann gute Bücher lesen. Die Info-Häppchen aus den Online-Medien informieren zwar, befördern aber auch die eigene Angst, den permanenten inneren Alarmzustand. Bücher hingegen entspannen die Seele.
Man kann, sooft es geht, wandern oder spazieren gehen. Für die Psyche ist es enorm wichtig zu erleben, dass die manifeste Wirklichkeit – die Natur, die Bäume, die Berge, die Tiere, die Strassenzüge, die greifbaren Aspekte dieser Welt – immer noch da sind – gänzlich unbeeindruckt vom menschlichen Treiben und Tun. Ganz so, als wäre in den letzten zweieinhalb Jahren überhaupt nichts Weltbewegendes geschehen.
Unser täglich Angst und unsere damit verbundene Bewusstseinsversklavung geschieht durch die Medien: Schaltet man diese ab, so ist die Schönheit der Welt wieder oder besser gesagt immer noch da.
Diesen Sommer war ich in Italien. Neapel, Rom, Perugia, Florenz, Venedig. Ich durfte neu entdecken, wie wundervoll es ist, sich mit völlig anderen Dingen als der Tagespolitik zu beschäftigen: Geschichte, Kunst, Aquädukte, Stadien, Imperien, die entstehen und vergehen. Steine und Gemälde, die von jenen vergangenen Imperien grosse Geschichten erzählen.
Italien ist ein wunderbares Land, um sich klein und demütig zu fühlen – angesichts einer Geschichte, die so viel grösser und würdevoller ist, als dass der totalitäre Gesellschaftsentwurf der letzten zweieinhalb Jahre sie auch nur annähernd auslöschen könnte. Von Italien aus wirkte alles, was ich am Rande aus Deutschland mitbekam, nur noch weit entfernt, bizarr und surreal.
Statt Twitter und Telegram, öffentliches Leben auf Strassen und Plätzen. Kinder, die noch spätabends mit ihren Familien zum Eis essen auf den Strassen unterwegs waren. Herausgeputzte Touristen aus aller Welt, die ihre schönsten Outfits spazieren führten. Der wohl bleibendste Eindruck dieser Reise war, wie hartnäckig gewisse Aspekte der Welt sich in ihrer zeitlosen Schönheit dem gegenwärtigen Totalitarismus entziehen: Auf dem Markusplatz in Venedig waren gefühlt noch immer so viele Tauben wie vor 20 Jahren, als ich das letzte Mal dort war.
Die Musiker auf dem Markusplatz spielten sich die Seele aus dem Leib beim «Americano». Das Publikum applaudierte begeistert. Am Ende des Freiluftkonzerts gab es ein Gewitter, und die Menge, die unter den Kolonnaden des Platzes Schutz vor dem Regen suchte, klatschte und jubelte bei jedem Blitz, der den venezianischen Himmel durchzog.
Die wohl wichtigste und von uns am häufigsten vernachlässigte Ressource in diesen Zeiten ist unser eigenes Bewusstsein. Die Gesundheit des eigenen Bewusstseins zu erhalten ist angesichts des auf unser Bewusstsein abzielenden Informationskrieges weder einfach noch banal, aber essenziell.
Dieser kleine Essay ist mein ganz persönliches Plädoyer dafür, das eigene Bewusstsein, auch angesichts aller Widrigkeiten im politischen Geschehen, angesichts tiefster Gesellschaftsspaltung, Krieg und persönlichen Entbehrungen, immer wieder neu anzueignen. Die Schönheit der Welt, die so viel grösser ist als die Tyrannei der letzten zweieinhalb Jahre, mit den Augen eines Kindes neu zu entdecken.
Denn wenn wir das nicht tun, entgleitet uns am Ende der Sinn, wofür wir diesen Kampf überhaupt führen: für das Schöne, Wahre und Gute, für ein Leben in Frieden mit unseren Mitmenschen hier auf Erden. Wenn wir das Leben nicht leben, für das wir diesen Kampf führen, werden wir am Ende nur noch ausgebrannt sein, von uns selbst entfremdet und süchtig nach dem nächsten Schuss – dem nächsten «Unser täglich Angst gib uns heute».
Die Welt ist so viel grösser und würdevoller, als dass sie von einem menschenverachtenden Regime wie dem derzeitigen jemals gecancelt werden könnte. Die Magie und Schönheit der Welt, sie ist immer noch da – und wir alle haben sie uns redlich verdient.
In diesem Sinne: Was auch immer uns in diesen verrückten Zeiten noch geschehen mag – Don’t panic! ♦
von Aya Velázquez
Hat dir der Artikel gefallen? Dann bestelle jetzt ein Abo in unserem Shop.
Deine Meinung ist uns wichtig: Teile dich mit und diskutiere im Chat mit unseren Lesern.