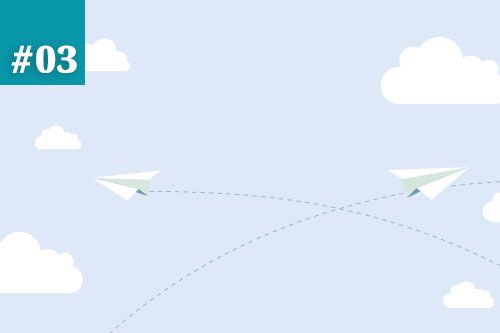Mitläufer sind solidarisch
Die Solidarischen werden stets dazu aufgerufen, die Unsolidarischen zu bekämpfen. Es ist mir kein Fall bekannt, in welchem Solidarität mit Unsolidarischen propagiert worden wäre. Damit steht die Solidarität im krassen Gegensatz zur Liebe, die selbst Feinden...