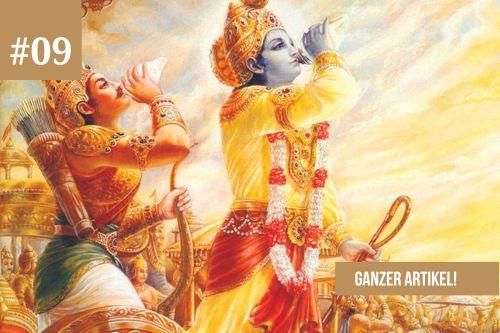Was ist eine gerechte Gesellschaft?
Zwiegespräch mit Marko Kovic und Titus Gebel
Titus Gebel ist erfolgreicher libertärer Unternehmer und fördert weltweit freie Privatstädte. Marko Kovic bekennt sich zum Sozialismus und ist als «Experte für Verschwörungstheorien» ein scharfer Kritiker der Bürgerrechtsbewegung. Wie sieht die Gesellschaft aus, die sie sich wünschen?
«DIE FREIEN»: Lieber Marko, lieber Titus, ihr habt beide sehr unterschiedliche politische Weltanschauungen. Wie stellt ihr euch eine lebenswerte Gesellschaft vor, und wie kann diese erreicht werden?
Titus Gebel: Eine lebenswerte Gesellschaft ist für mich gekennzeichnet durch das Motto «Leben und leben lassen», sodass jeder nach seiner Façon glücklich werden kann. Wir möchten alle in Frieden leben, wir möchten nicht totgeschlagen oder ausgeraubt werden – das will nicht mal ein Krimineller. Da haben wir alle eine hundertprozentige Übereinstimmung – bei allem, was darüber hinausgeht, nicht. Aber heute haben wir Systeme, in denen die Mehrheit entscheidet und die Minderheit zu Dingen zwingt, die sie eigentlich nicht möchte. Und dieses System wird natürlich gekapert von allen möglichen Interessengruppen, was zu einem permanenten politischen Konflikt führt, um die Mehrheit zu erringen, Gesetze zu verabschieden oder abzuwehren. Ich nenne das einen unsichtbaren Bürgerkrieg. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass sich jeder auf das konzentriert, was er am besten kann, und das geht nur, wenn wir den Staat beschränken auf Schutz von Freiheit, Leben, Eigentum. Weil er, sobald er darüber hinausgeht, Missbrauch betreibt.
Wie kommen wir da hin?
TG: Schwierige Frage. Meine Erfahrung ist, dass die meisten das gar nicht wollen, das muss ich auch akzeptieren. Das Problem in der Demokratie ist, dass man den Wählern tendenziell immer mehr verspricht, um gewählt zu werden. Dadurch steigt die Staatsquote an und irgendwann sind so viele Leute und Unternehmen direkt oder indirekt vom Staat abhängig, dass das System nicht mehr reformierbar ist. Die Idee des schlanken Staats funktioniert in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Deshalb denke ich, dass man sich komplett aus dem System rausnehmen und alternative Systeme von ausserhalb anbieten muss, aber ausschliesslich für Freiwillige. Ich habe mir so ein System überlegt: die Freie Privatstadt, in der wir anstelle des Staats alle Dienstleistungen privat erbringen. Wenn es Interessenskonflikte gibt, werden sie vor unabhängigen Schiedsgerichten ausserhalb unserer Organisation ausgehandelt. Es ist volle Vertragsfreiheit gegeben, sodass sich die Zivilgesellschaft spontan so entwickeln kann, wie sie das möchte. Aber man kann eben nicht andere dazu zwingen, nach seiner Pfeife zu tanzen. Auch dann nicht, wenn man die Mehrheit hat.
Wie weit sind diese Pläne fortgeschritten?
TG: In der Praxis ist es natürlich schwierig, denn man muss mit bestehenden Staaten verhandeln, die bereit sind, so ein Experiment durchzuführen. Das geht mit Staaten, die sowieso schon Sonderwirtschaftszonen haben und sich überlegen, so etwas auch für Bürger zu machen, sodass man dort auch wohnen kann. Es gibt seit einigen Jahren den Trend hin zu solchen Zonen, weil einige Staaten sich auch einen Wettbewerbsvorteil davon versprechen. Es ist aber noch ganz am Anfang und in der Schweiz eigentlich ausgeschlossen.
Marko Kovic: Du hast die Diagnose der Pathologie von einem zu grossen Staat, der sich plagt mit Partikularinteressen – das würde ich sogar ein Stück weit teilen. Aber habe ich richtig verstanden, dass du denkst, das ist die Konsequenz des demokratischen Systems an sich? Du denkst also nicht, dass eine Demokratie funktionieren kann ohne diese Pathologien? …
von Christian Schmid Rodriguez
Du möchtest den ganzen Artikel lesen? Dann bestelle jetzt die 09. Ausgabe oder gleich ein Abo in unserem Shop.
Deine Meinung ist uns wichtig: Teile dich mit und diskutiere im Chat mit unseren Lesern.