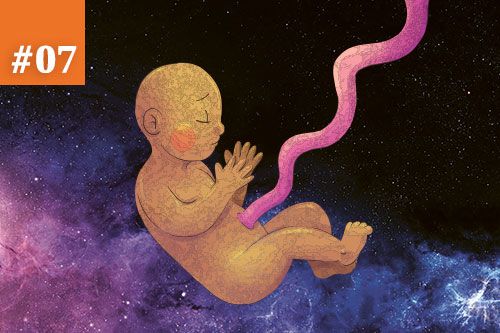Gemäss Arthur Schopenhauer sehen wir die Dinge nicht so, wie sie tatsächlich sind, sondern wie sie für uns sind. Das bedeutet, dass für acht Milliarden Menschen acht Milliarden Wirklichkeiten existieren.
Leben ist Leiden. Heisst es im Buddhismus. Manchmal könnte man sicher weniger leiden. Zum Beispiel, indem man sich nicht angegriffen fühlt oder sich entscheidet, sich über den, über den man sich gerade ärgert, nicht mehr zu ärgern. Da auch derjenige leidet, der sich Illusionen über sich selbst macht, auch wenn ihm das nicht unbedingt bewusst ist, empfiehlt sich überdies, diese Illusionen fallenzulassen. Fraglich ist etwa, ob unser Wille tatsächlich so frei ist wie wir es gerne hätten. Er scheint in seiner Absolutheit eine Illusion, da nicht von der Hand zu weisen ist, dass unsere Entscheidungen von zig Faktoren abhängen.
Auch wäre einzugestehen, dass wir beständig Einflüsterern ausgesetzt sind, die uns gemäss ihrer Vorstellungen manipulieren wollen. Niemand ist davon ausgenommen, es sei denn, er lebt als Eremit in einer Höhle wie einst Nietzsches Zarathustra. Man hüte sich also vor der Täuschung, man wäre gegen Fremdsteuerung immun. Ist der nächste Gedanke, den wir denken, tatsächlich ein originär eigener Gedanke? Woher kommt er wirklich? Wer könnte wollen, dass wir ihn denken? Vielleicht sind wir gar unser eigener Einflüsterer?
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) würde antworten, dass wir das ganz sicher sind. Und zwar konstant. Weil wir uns in unserer Wahrnehmung selbst manipulieren, indem wir sie subjektiv färben – nicht weil wir es wollen, sondern weil wir nicht anders können. Eine nächste Illusion wäre also, dass wir jemals in eine Position kommen könnten, die uns zur Objektivität befähigt. «Die Welt ist meine Vorstellung: – dies ist die Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt», schreibt der deutsche Philosoph in seinem erstmals 1819 erschienenen und 1844 und 1859 erweiterten Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung».
Rechthaberei ist völlig sinnlos
Wie wir die Welt sehen, hat also gemäss Schopenhauer nur mit uns zu tun. Pippi Langstrumpf würde salopp sagen, dass wir uns die Welt machen, wie sie uns gefällt. Max Frisch würde beisteuern, dass jeder sich eine Geschichte erfindet und sie für sein Leben hält. Die Aussagen zielen zwar nicht auf genau dasselbe, aber im Kern verweisen sie darauf, dass wir der Urheber dessen sind, was wir Realität nennen. Es gibt also keine andere Wirklichkeit als die, die wir meinen. Und das bedeutet bei rund acht Milliarden Menschen weltweit, dass rund acht Milliarden Wirklichkeiten existieren. Würden wir das im Miteinander berücksichtigen, ginge es wohl ziemlich friedlich unter den Menschen zu. Vor allem die Rechthaberei hätte ausgedient und würde endlich erkannt als das, was sie ist: völlig sinnlos.
Erübrigt sich demnach auch, um das zu ringen, was man allgemeinhin Wahrheit nennt? Ist es falsch, diesbezüglich einen faustschen Eifer zu entwickeln? Darf jemandem zugestanden werden, eine für alle gültige Wahrheit erkannt zu haben? Oder verfangen wir uns auch hier im Illusionären? Wahrheit und Wirklichkeit müssen unbedingt unterschieden und präzise definiert werden, zugleich aber verweist ihre häufige Gleichsetzung auf eine anthropologisch konstante Sehnsucht: Wir wollen, dass unsere Wirklichkeit auch für alle anderen ihre Gültigkeit hat und also als Wahrheit anerkannt wird. Doch was verlangen wir da eigentlich?
Selbst wenn wir denselben Berg sehen, ist er doch nicht derselbe. Mehr noch, und hier zu Schopenhauer zurück, unsere individuellen Vorstellungen verhindern, ihn so zu sehen, wie er tatsächlich ist. Und das heisst, dass wir über das wahre Wesen der Dinge nichts erfahren, dass wir niemals dahin vordringen können. Insofern existiert eine Art Parallelwelt, die unerreichbar bleibt, auch wenn wir das in der Regel ignorieren, weil es uns gar nicht bewusst ist beziehungsweise es uns schwerfällt, das anzuerkennen.
Unsere Wahrnehmung färbt die Dinge individuell
Schopenhauer stützte sich in seinen Aussagen über die Erkenntnisfähigkeit des Menschen an die philosophischen Untersuchungen Immanuel Kants, der in seinem erkenntnistheoretischen, im Jahr 1781 erstveröffentlichten Hauptwerk «Kritik der reinen Vernunft» ausführte, «dass wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen». «A priori» meint Erkenntnisse, die ohne die Einwirkung unserer Wahrnehmung Gültigkeit haben. Diese Erkenntnisse bleiben uns versperrt, da wir unsere Wahrnehmung als Instrument brauchen und die Wahrnehmung wiederum eine individuelle Färbung auf die Dinge legt. Auch Kant kommt also zu der Schlussfolgerung, dass wir die Wirklichkeit, wie sie ist, nie erkennen können, sondern nur die Wirklichkeit, wie wir sie konstruieren. Wir erfassen die Dinge also nicht «an sich», sondern «für uns». Schopenhauer merkte diesbezüglich übrigens kritisch an, dass darin der menschliche Egoismus begründet sei.
Zu unseren Vorstellungen kommen wir durch unsere Sinne. Wir müssen also den Weg durch den Körper nehmen, er ist sozusagen unser Hilfsmittel, oder spirituell ausgedrückt, unser Medium. Zugleich aber sind unsere Sinne, wie Schopenhauer deutlich macht, genau das Hindernis, das eine unmittelbare Wahrnehmung verunmöglicht. Auch wenn wir gewohnheitsmässig sagen würden, dass der Berg grau sei, entspricht das nicht dem, was wir tatsächlich aussagen können. Wollten wir den Vorgang so präzise wie möglich beschreiben, so müssten wir uns wie folgt äussern: «Meine Augen vermitteln mir, dass mir dieser Berg grau erscheint.» Man mag das für spitzfindig halten. Genauer betrachtet konstituiert dieser Unterschied allerdings ein fundamental anderes Dasein in der Welt. Wer sich im Gewahrsein hält, dass er nicht zu dem Eigentlichen der Dinge dringen kann, mag bisweilen vielleicht verzweifeln, wird sich aber gewiss eine wohltuende Demut bewahren.
Alles trägt einen Willen in sich
Wer sich damit nicht abfinden will, dem bietet Schopenhauer dennoch ein Verständniswerkzeug an, um das Wesen der Dinge zu erfassen. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch, zielt aber auf eine Ebene, die nicht über die Vorstellung steuerbar ist – Schopenhauer bezeichnet sie als «Wille». Damit aber meint er etwas grundlegend anderes als wir allgemeinhin darunter verstehen. Ihm zufolge handelt es sich um eine von der Natur gegebene, universale Kraft, die in jedem Lebewesen steckt, und also das Prinzip des Lebendigen schlechthin ist. Der Wille umfasst demnach auch alle Naturphänomene wie das Wetter und die Gravitation. Ihn zu kontrollieren ist nicht möglich, wir sind ihm quasi ausgeliefert. Daher ist er beim Menschen auch mit dessen Trieben gleichzusetzen, wenn auch nicht ausschliesslich.
Weiterhin bleibt zwar, dass wir das «Ding an sich» nicht wahrnehmen können, aber da es ebenso den Willen in sich trägt, wie wir den Willen in uns tragen, kennen wir es quasi aus unserer eigenen Erfahrung und dringen auf diese Weise zu ihm vor. Das freilich kann man glauben oder nicht. Zuallererst ist es eine nächste Möglichkeit, sich mit einer vielleicht fremden Perspektive vertraut zu machen, um es sich nicht in den eigenen – vermeintlichen – Gewissheiten allzu bequem einzurichten. ♦
von Sylvie-Sophie Schindler
Hat dir der Artikel gefallen? Dann bestelle jetzt ein Abo in unserem Shop.
Deine Meinung ist uns wichtig: Teile dich mit und diskutiere im Chat mit unseren Lesern.