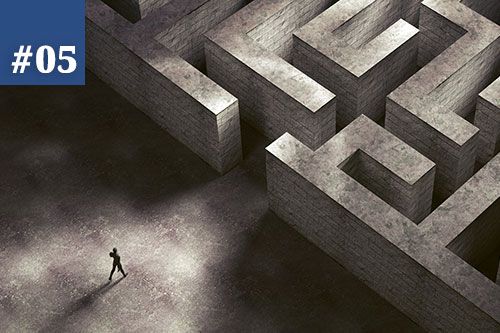Macht, Moral, Mut
Das Streben nach der Erlösung von der Klimaschuld.Es ist der Traum jeder Politik, die von Machtstreben und Gesinnungsmoral geleitet wird: ein absoluter, unhinterfragbarer Massstab, der praktisch jede Massnahme rechtfertigt. In Thomas Eisingers Roman «Hinter...